(Fest: 20. Juli)
von P. Marc Brüllingen
Die hl. Margareta von Antiochien, Jungfrau und Märtyrin, ist eine der mächtigsten Fürbitterinnen unter der Gruppe der „Vierzehn Nothelfer“. Als Drachenbekämpferin ist sie mit dem hl. Georg, dessen Schicksal nach einigen Quellen mit dem ihren sogar verknüpft gewesen sein soll, eine der beliebtesten und ältesten Heiligengestalten. Historische Akten über ihr Leben sind nicht mehr vorhanden, ihr Martyrium wird in der Zeit der Verfolgungen unter Diokletian angenommen, ihr Todesjahr mit 307 angegeben. Im Martyrologium Romanum steht ihr Name unter dem 20. Juli. Einige sehen in ihr jene Königstochter, die der hl. Georg in seinem Kampfe mit dem Drachen befreit hat. Sicherlich ist hierbei bedeutsam, daß es Margareta nicht erspart blieb, selbst einen Drachen zu besiegen. Das Gedächtnis ihres Festes ist in der abendländischen Kirche seit dem 12. Jahrhundert am 20. Juli verzeichnet, in der griechischen, wo sie Marina genannt wird, seit alters her am 13. Juli. Viele andere heilige und selige Frauen tragen ihren Namen, darunter Margareta von Cortona, Margarita von Schottland, Margareta Maria Alacoque.
Die hl. Margareta wird immer mit dem Drachen dargestellt, den sie mit Kreuzstab oder Kruzifix besiegt; er bedeutet den Teufel und liegt zu ihren Füßen. Manche Darstellungen zeigen sie reich gekleidet als Königstochter mit Perlendiadem – dem Zeichen der Reinheit aufgrund ihres Namens -, ferner mit Fackel und Kamm – ihren Marterwerkzeugen -, auch mit Engel, der ihr Palme und Siegeskrone reicht; zusammen mit den hll. Barbara und Katharina von Alexandrien als die sogenennten „heiligen drei Madl“.
Margareta ist Patronin des Nährstandes, weil ihr Fest ein wichtiger Merktag für Bauern war, der Jungfrauen, vor allem auch der Gebärenden, und für glückliche Entbindung, gegen Unfruchtbarkeit. Sie wurde in der Nothelfergruppe aufgenommen, weil sie unmittelbar vor ihrem Martertod Gott gebeten hatte, allen Müttern, die sich in ihrer schweren Stunde an sie um Fürbitte wendeten, zu helfen. Reliquien der Heiligen befinden sich in Montefiascone bei Bolsena nördlich von Rom. Hier ist ihr der Dom geweiht, den Michele Sammicheli in dem einzigartig gelegenen Bergort errichtete. Montefiascone hat in der Stauferzeit eine große Rolle gespielt.
Es gibt kaum einen großen Künstler, den die Darstellung dieser heldenhaften Jungfrau nicht angeregt hätte, darunter Raffael, Palma, Tizian, Lucas Cranach, Guercino, Le Suer, Poussin u.a.
Legende
Margareta bedeutet „Perle“. Sie war die Tochter eines heidnischen Priesters in Antiochien. Nach dem frühen Tode ihrer Mutter übernahm eine Amme die Obhut über das Mädchen und erzog es heimlich im Christenglauben. Als Margareta zur Jungfrau herangewachsen war, bekannte sie ihrem Vater, daß sie Christin sei. Dieser überschüttete sie mit Vorwürfen, vermochte aber weder mit Bitten noch mit Drohungen, ihren Sinn zu ändern. Da schickte er sie zur Strafe in die Verbannung.
Hier hütete Margareta die Schafe. Da geschah es, daß der Präfekt Olybrius vorbeiritt, und als er die schöne Jungfrau erblickte, in Liebe zu ihr entbrannte. Er sprach zu seinen Knechten: „Gehet und holt mir die Jungfrau; ist sie von edler Geburt, so will ich sie zur Ehe nehmen, ist sie eine Magd, so soll sie meine Beischläferin sein.“ Also wurde Margareta vor ihn gebracht, und er fragte sie nach ihrem Namen und ihrer Herkunft. Sie antwortete ihm, daß sie Margareta heiße, aus einem edlen Geschlecht stamme und Christin sei. Da drang Olybrius in sie, sie solle ihren Christenglauben abschwören. Margareta aber antwortete ihm fest, daß sie an die Erlösung durch den lebendigen Sohn Gottes glaube und niemals davon ablassen werde.
Als Olybrius sich mit seiner Werbung abgewiesen sah, wurde er wütend und befahl, sie ins Gefängnis zu werfen. Andern Tags ließ er sie vor die Götzen führen und versuchte sie zum Opfer zu zwingen. Sie aber weigerte sich standhaft. Da ließ er sie aufs grausamste foltern. Sie wurde mit Ruten geschlagen, und man riß ihr mit eisernen Kämmen das Fleisch vom Leibe. Alle, die dabeistanden, weinten, daß eine so wundersame Schönheit so gräßlich zerstört wurde.
Aber Margareta erlitt alle Qualen des Leidens ohne Wanken. Wieder in den Kerker geworfen, wartete ihrer ein noch härterer Kampf. Auch die Heiligen sind Menschen; in der Dunkelheit des Kerkers mag sie von Angst und Schmerzen gepeinigt gewesen sein und Schwäche nach ihrem Herzen gegriffen haben. Da erschien vor ihr ein greulicher Drache und wollte sich auf sie stürzen, um sie zu verschlingen. Allein Margareta rüstete sich beherzt zum neuen Kampf. Schließlich schlug sie mit letzter Kraft das Kreuzzeichen über das Untier. Dann packte sie es mutig und warf es zur Erde nieder und setzte den Fuß auf seinen Scheitel.
Der Teufel in der Gestalt des Drachen aber schrie laut: „Weh mir, nun bin ich von einer schwachen Jungfrau überwunden worden“ – und verschwand alsbald. Und mit einem Mal wurde ihr Gefängnis von einem wunderbaren Licht durchstrahlt, das gab ihr himmlische Kraft und sie war getrost.
Als sie am nächsten Tage dem Präfekten wieder vorgeführt wurde, sah dieser sie zu seiner größten Verwunderung heil an Leib und Seele vor sich stehen, schöner und blühender denn zuvor. Er forderte sie wieder auf zu opfern. Sie aber entgegnete ernst, daß sie niemals tote Götzen anbeten würde. Da befahl er in seinem großen Haß, glühende Fackeln herbeizubringen und sie damit zu brennen, hernach aber zur größeren Pein in ein Faß mit kaltem Wasser zu werfen.
Alle, die dabei waren, staunten, daß eine so zarte Jungfrau so große Qualen aushielt. Aber plötzlich erbebte die Erde, und die Jungfrau stieg unversehrt aus dem Fasse hervor. Als das Volk dies Wunder sah, lobten viele den Christengott und bekehrten sich; – sie wurden aber alle um Christi Namen willen enthauptet. Der Richter fürchtete, es würden sich ihrer noch mehr zu Christus bekennen. Da ließ er Margareta schnell auf den Richtplatz führen, damit sie durch das Schwert getötet werde. Hier bat Margareta, die große Märtyrin, um eine kurze Frist. Sie kniete nieder und betete für ihre Verfolger und für diejenigen, die ihr Gedächtnis feiern würden und ihren Namen in ihren Nöten anrufen. Dann bot sie dem Henker mutig ihren Nacken dar.
Er schlug ihr mit einem Streiche das Haupt ab, und sie empfing die Märtyrerkrone.
Über ihrem Grabe wurde später zu Antiochien eine Kirche erbaut, und durch die Kreuzfahrer wurde ihr glorreicher Name auch im Abendlande bekannt. Viele, die ihren Namen anriefen, haben große Hilfe erfahren.
(nach: Das große Buch der Heiligen – Geschichte und Legende im Jahreslauf ; Erna und Hans Melchers; Bearbeitung: Carlo Melchers; Südwest Verlag München; 9. Auflage 1986)



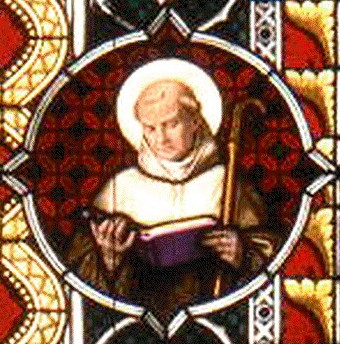





















































 „Epiphanie“ (griechisch = Erscheinung) heißt im Lateinischen daneben auch apparitio, manifestatio, declaratio, ostensio Domini, Fest der Erscheinung des Herrn, d.h. der Offenbarung seiner Gottheit, ein Fest des Herrn am 6. Januar; heute ohne die seit dem 6. Jahrhundert übliche Vigil und auch ohne eine eigentliche Oktav, die für Jerusalem um 400 und für die römisch-fränkische Liturgie im 8. Jahrhundert bezeugt ist, wohl aber mit einer Art Nachfeier, deren 8. Tag abendländischer Tradition gemäß Commemoratio baptismatis D. N. J. Christi (= Fest vom Gedächtnis der Taufe unseres Herrn Jesus Christus) heißt. Die rein volkstümliche Bezeichnung festum magorum (= Fest der Magier) oder Fest der Heiligen Drei Könige in romanischen und germanischen Sprachdialekten hängt wohl besonders mit der Übertragung ihrer Gebeine von Mailand nach Köln (1164) zusammen.
„Epiphanie“ (griechisch = Erscheinung) heißt im Lateinischen daneben auch apparitio, manifestatio, declaratio, ostensio Domini, Fest der Erscheinung des Herrn, d.h. der Offenbarung seiner Gottheit, ein Fest des Herrn am 6. Januar; heute ohne die seit dem 6. Jahrhundert übliche Vigil und auch ohne eine eigentliche Oktav, die für Jerusalem um 400 und für die römisch-fränkische Liturgie im 8. Jahrhundert bezeugt ist, wohl aber mit einer Art Nachfeier, deren 8. Tag abendländischer Tradition gemäß Commemoratio baptismatis D. N. J. Christi (= Fest vom Gedächtnis der Taufe unseres Herrn Jesus Christus) heißt. Die rein volkstümliche Bezeichnung festum magorum (= Fest der Magier) oder Fest der Heiligen Drei Könige in romanischen und germanischen Sprachdialekten hängt wohl besonders mit der Übertragung ihrer Gebeine von Mailand nach Köln (1164) zusammen. St. Kunibert in Köln gehört zu dem großartigen Kranz der romanischen Kirchen dieser Stadt. Zwar ist das Bauwerk im letzten Kriege schwer getroffen worden, aber der Wiederaufbau fast beendet. Die Kirche erhebt sich an der gleichen Stelle dicht am Rhein, wo der hl. Kunibert, Bischof von Köln, das nach ihm benannte Stift (aufgelöst 1802) gründete, in dessen Kirche er im Jahre 663 seine Ruhestätte fand. Diese Kirche birgt auch die Reliquien der hll. Ewalde.
St. Kunibert in Köln gehört zu dem großartigen Kranz der romanischen Kirchen dieser Stadt. Zwar ist das Bauwerk im letzten Kriege schwer getroffen worden, aber der Wiederaufbau fast beendet. Die Kirche erhebt sich an der gleichen Stelle dicht am Rhein, wo der hl. Kunibert, Bischof von Köln, das nach ihm benannte Stift (aufgelöst 1802) gründete, in dessen Kirche er im Jahre 663 seine Ruhestätte fand. Diese Kirche birgt auch die Reliquien der hll. Ewalde.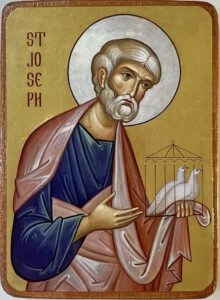 Am 19. März feiert die hl. Katholische Kirche das Fest eines Heiligen, dessen Verehrung weit verbreitet ist und dessen Fürbitte und Beistand inständig angerufen wird – das Fest des hl. Joseph.
Am 19. März feiert die hl. Katholische Kirche das Fest eines Heiligen, dessen Verehrung weit verbreitet ist und dessen Fürbitte und Beistand inständig angerufen wird – das Fest des hl. Joseph.