von P. Andreas Fuisting
Ich erinnere mich gut daran, als kleiner Junge häufiger vom „Herrgottsbrüderle“ gehört zu haben, besonders dann, wenn ich mit Erwachsenen spazierengehend am Franziskanerkloster in meiner Heimatstadt Düsseldorf vorbeikam, wo er in der Krypta beigesetzt ist. Dabei befremdete meine rheinländischen Ohren das „-le“, was ich nicht deuten konnte. Später erfuhr ich den Grund: Bruder Firminus war Schwabe.
Geboren in Massenbachhausen (Kreis Heilbronn) wurde Josef Wickenhäuser am 19. Januar 1876 als Sohn einfacher und armer Eltern. Sein Vater Adam war Schäfer von Beruf. In zweiter Ehe heiratete dieser Elisabeth Merkle, die Mutter Josefs. Sie galt als tiefreligiöse und geduldige Frau. Das Vorbild seiner christlichen Eltern war die beste Anleitung für Josef zu heiliger Gottesfurcht und christlicher Frömmigkeit. Sein Vater starb 1891; ab diesem Zeitpunkt mußte Josef für den Unterhalt seiner Mutter sorgen. In seiner Pfarrkirche empfing er die Hl. Taufe und diente als Bub seinem Pfarrer als vorbildlicher Meßdiener am Altar, wo er 1889 die erste Hl. Kommunion empfing. In Kirchhausen wurde Josef 1892 gefirmt. Nach der Schulentlassung (Volksschule in seinem Heimatdorf) arbeitete er zur Unterstützung seiner Eltern in einem Steinbruch. Mit 16 Jahren begann Josef seine Lehre bei Steinmetz Pisot in Kirchardt. Diesem viel sogleich die außergewöhnliche Frömmigkeit und Redlichkeit seines Lehrlings auf, der sich niemals dazu verleiten ließ, gegen sein Gewissen zu handeln. Wurde er von Kameraden ausgelacht oder verspottet, ließ er sich nicht beirren und setzte sich meistens durch. Sah er bei Hänseleien die Nutzlosigkeit persönlicher Rechtfertigung ein, schwieg er lieber.
Mit einem guten Zeugnis ging Joseph als Steinmetz nach Stuttgart in das Grabsteingeschäft Schönleber. Hier lernte er die eigentliche Bildhauerarbeit, Punktieren und Modellieren. Seine freien Stunden galten Weiterbildung und Gebet. Früh auf sich allein gestellt, brachten Wanderjahre ihn bis ins Rheinland und nach Berlin. 1896 kam Josef zum Militärdienst beim Infanterieregiment „Kaiser Franz Josef“. Das Soldatenleben konnte ihn aus seiner gewohnten und gesuchten Christusverbundenheit nicht herausholen.
In Stuttgart lernte Josef das Hausmädchen Maria Farny kennen, die wegen ihrer Frömmigkeit und heiteren Wesensart von ihm geschätzt wurde. Sie versprachen sich einander die Ehe. Während seiner Wanderjahre forderte seine Verlobte von ihm eine Entscheidung. Josef entschied sich dazu dem Ruf Gottes zu folgen und gab Maria frei. Nach dem Tod seiner Mutter (1905) gab er seiner längst vernommenen Berufung endgültig nach und beschloß nun ganz für Gott da zu sein.
1906 erbat er die Aufnahme in den Franziskanerorden. Nachdem er mehrer Klöster besucht hatte, um im franziskanischen Geist geschult zu werden, kam Bruder Firminus, diesen Namen hatte er nach altem Brauch bei der Einkleidung erhalten, schließlich nach Düsseldorf. 1912 berichtete sein Novizenmeister: „Bruder Firminus faßt das Ordensleben ideal auf. Er zeigt großen Eifer im Tugendstreben und in seinem ganzen Verhalten den sicheren Ordensberuf.“
Mit Brüdern aus anderen Ordensgemeinschaften tat unser Bruder im Ersten Weltkrieg Dienst als Malteser überall, wo man ihn brauchen konnte: im Bahnhofsdienst, in Krankensälen und im Operationssaal. Keine Arbeit war ihm zu schwer und keine Zeit zu ungelegen in der Betreuung der Verwundeten. Einmal schreibt er. „Es wurde mir sehr schwer, die schrecklichen Wunden zu verbinden. Doch mit Gottes Hilfe konnte ich das Opfer bringen. Täglich gehe ich in der Frühe eine Stunde weit zur Kirche, um mir in der Feier der Hl. Messe die Kraft für mein schweres Tagwerk zu holen.“
Inzwischen war – auch während des Krieges – zu einer seiner Hauptaufgaben die Bildhauerei geworden. Trotz zahlreicher ehrenvoller Bildhauerarbeiten (Kaiser Wilhelm II. schätzte seine Arbeiten und grüßte ihn im Lazarett von St. Remi einmal mit: „Sind Sie der verkappte Michelangelo?“), hat er nie diese Arbeit, bei der er Adelsleute, Politiker und hohe Militärs modellierte, zum Gegenstand seines Lebens im soldatischen Dienst gemacht. Für ihn gab es nur Gott. Eine Anekdote verdeutlicht das. Als Firminus einmal gefragt wurde, ob er auch sonntags an einer Büste arbeiten könne, gab er die klare Antwort: „… ich pflege sonntags nicht zu abreiten, sondern zu beten und an mir zu modellieren.“
Zum Kriegsende November 1918 kam Bruder Firminus endlich ins Kloster Düsseldorf zurück und durfte nun wieder ganz Ordensmann sein. 1910 legte er die Ewigen Gelübde ab bis zum Tode. Vorbehaltslos ging er weiter auf sein Ideal zu, wie der hl. Franziskus es aufgestellt hat: Regel und Leben der Minderbrüder ist dies: Das hl. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus zu beobachten und zu leben in Armut, Gehorsam und Jungfräulichkeit. In seinen Aufzeichnungen lesen wir. „Es ist mein einziger Wunsch, daß ich ein immer besserer Minderbruder werde.“
Zwischen 1919 und 1924 erhielt der Bruder den Auftrag, an der St. Apollinariskirche in Remagen größere Restaurierungsarbeiten auszuführen. Es war zumeist eine mechanisch – technische Arbeit. Diese lag ihm eigentlich nicht. Aber er wollte nicht aufgeben oder um eine andere Arbeit bitten. Ihm galt der Auftrag als Auftrag Gottes.
Seine Haupttätigkeit als Bruder, aus Steinblöcken Kunstwerke herauszuarbeiten, blieb die Gesundheit des Firminus betreffend, nicht ohne Folgen. Er erkrankte an der berüchtigten Staublunge, bei der sich durch feinste Ablagerungen krankhafte Veränderungen am Lungengewebe zeigen. Als Folge bildete sich eine Schädigung des Herzens heraus, was mit der Zeit den ganzen Körper in Mitleidenschaft zog. Im Frühjahr 1939 wurde er ins Krankenhaus eingewiesen. Vorausahnend, daß sein Heimgang zum Herrn nicht mehr lange auf sich warten lassen würde, ließ er sich nur Geld für die Hinfahrt geben. Trotz seines elenden Zustandes fanden ihn die Krankenschwestern häufig neben seinem Bett knien und beten. „Für Gott allein! So wirst du hier und ewig glücklich sein!“ So betete er! Wenn der Bruder konnte, half er den Schwestern beim Kranken- und Wirtschaftsdienst. Gern besuchte er die anderen Kranken, um ihnen durch sein Wort und seine Güte zu helfen. So ging Firminus betend, leidend, liebend und dienend seinem Heiland entgegen. Am 30. September 1939 verstarb er, nachdem ihm in der Krankenhauskapelle morgens noch die hl. Kommunion gereicht worden war. Am gleichen Tag wurde er ins Kloster überführt und im Klostergang aufgebahrt. Eine große Zahl an Verehrern brachte Blumen her und berührte seinen Leichnam mit Rosenkränzen.
Am 3. Oktober wurde Br. F. Wickenhäuser auf dem Friedhof in Stoffeln (Düsseldorf) beigesetzt. Die Anteilnahme der Bevölkerung war überraschend groß, hatte doch gerade erst der Zweite Weltkrieg begonnen. Nachdem die Friedhofsverwaltung die „häufigen und wiederholten Besuche des Grabes“ bestätigen konnte, leitete Joseph Kardinal Frings, Erzbischof von Köln, auf Bitten der Ordensgemeinschaft der Franziskaner am 29. April 1957 den Seligsprechungsprozeß ein. Am 14. September des Jahres 1957 schließlich wurden die Gebeine in die Bruder-Firminuskrypta des Franziskanerklosters in Düsseldorf überführt und dort beigesetzt.
Die Eigenschaften eines Heiligen
Demut:
Bruder Firminus machte seinem Ordensnamen alle Ehre. „Der Beständige“ war er gewiß, der in unerschütterlichem Glauben fest und beständig seinen Ordensweg ging. Dabei war er sich bewußt, aus der Kraft und Treue Gottes zu leben. In einer Mischung aus Humor und demütiger Überzeugung gab Firminus seinem Namen eine andere Deutung. Er sah sich als den „Vier – minus“, dessen Leben nur die Note „schwach ausreichend“ verdiente. Mit der „vier minus“ signierte er sogar seine Kunstwerke. Er wollte damit auf seine Art zeigen, was er war: nach der Regel des Ordensgründers Franziskus ein „Minderbruder“, der im Geist und in der Nachfolge Christi bereit ist, im selbstlosen Dienst an den Armen, Leidenden und Verachteten den letzten Platz einzunehmen.
Nächstenliebe:
Unter dem Beinamen, „Das Herrgottsbrüderle von Düsseldorf“ ist Bruder Firminus bekannt geworden. Zwar wurde ihm dieser Name wohl von Menschen verliehen, die ihn gut kannten und sein geistliches Leben schätzten; aber selbst trägt er auch Anteil daran. Es war nämlich seine Gewohnheit die Mitmenschen „Herrgottsbrüderle“ oder “ -schwesterle“ zu nennen. In dieser Kurzformel gab er seine Sicht vom Menschen wider: Jeder Mensch steht im Schnittpunkt der Gottesliebe (Herrgott) und Nächstenliebe (Bruder und Schwester). So schreibt er einmal: „Da jeder Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und unser Bruder und unsere Schwester ist, so ist infolgedessen unsere Nächstenliebe der heilige Maßstab unserer Gottesliebe.“
Es findet sich in der Hl. Schrift häufiger die Rede, daß Gott selbst seinen Getreuen einen neuen Namen geben wird. Besonders Freunden und Vertauten offenbart Gott diesen Namen bereits zu Lebzeiten, wie die Geschichte der christlichen Spiritualität zu berichten weiß. In diesem Zusammenhang bedeutet „Name“ das umfassende göttliche und menschliche Geheimnis der Person. „Herrgottsbruder“ könnte wohl ein solcher Name sein.
Beten:
Bruder Firminus beeindruckte viele durch seine innere Sammlung beim Gebet. Dieses war im Laufe der Jahre so sehr zur Mitte seines Lebens geworden, daß von einem beständigen und unaufhörlichen Gebetsgeist, der ihn beseelte, gesprochen werden kann. Er betete immerzu: in der Kirche, in der Werkstatt, bei jeglicher Arbeit und Freizeit. Stets war er sich der Gegenwart Gottes bewußt. So war er ein lebendiges Vorbild des Gebetes, das anderen Mut machte und zur Nachahmung anregte.
Gebet ist immer eine Begegnung mit Gott, in der Er seinen heiligen und liebenden Willen mit den unvollkommenen und oft so unheiligen Selbstentwürfen des Menschen durchkreuzt. Im Gebet offenbart Gott seinem geliebten Geschöpf stets neu seine Wahrheit und bietet ihm die Gemeinschaft seiner Liebe an. Firminus hat die Größe, aber auch die Schwierigkeiten der gottgewollten Umgestaltung durch das Gebet zutiefst erfahren. Er sagt selbst dazu: „Weil Gott mich liebt, will er mich auch trotz meiner Sünden noch heilig machen. Ich muß deshalb auch im Kreuz und Leid auf Gott vertrauen, ja, in Kreuz und Leid erst recht. Auch jede Schwierigkeit im Gebet läßt Gott zu, damit ich durch dieses Kreuz von meinen bösen Neigungen gereinigt, in der Tugend immer wieder geübt und schneller zur Vereinigung mit ihm gebracht werde. Die trockenen Stunden, wo ich nicht mit Trost und Genuß beten kann, will ich im Geiste der Buße und Sühne annehmen.“
In seiner Arbeit als Künstler:
Bruder Firminus liebte seinen Beruf und seine Arbeit. Doch stand bei ihm nicht die Leistung, sondern die Gesinnung im Mittelpunkt seines Schaffens. Er sah in seiner Tätigkeit einen „Dienst an der Schöpfung“ und zur Ehre Gottes und zum Heil und Wohl der Menschen. Neben dem Gebet war für ihn die Arbeit das beste Mittel, um seine wahre Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu sich unter Beweis zu stellen.
Große handwerkliche Fähigkeit, die ihn zum Steinmetz befähigte, verband sich bei ihm mit einer künstlerischen Begabung, die ihn zum Bildhauer werden ließ. Diese Tätigkeit am Stein wurde für ihn zu einem tiefen Sinnbild und Gleichnis. Sie schenkte ihm die Schau, daß es bei jeder Arbeit im Grunde darum geht, ein Kunstwerk zu schaffen, das vollkommen ist und nie vergeht. Ein solches Kunstwerk aber kann nur gelingen, wenn menschliches Handeln und göttliches Wirken Hand in Hand gehen. Es gelingt, wenn Gottes Hand den Meißel führt, mit dem unser Leben geformt und gestaltet wird, damit wir „dem Bilde seines Sohnes gleichgestellt werden“ (vgl. Röm 8,28 f.).
Besucher, und Bewunderer seiner Kunstwerke lernten seine Sicht dieses tiefen Sinngehalts menschlichen Wirkens kennen, wenn er ihnen sagte: „So wie ich mit Hammer und Meißel arbeite, so arbeitet der liebe Gott an unserer Seele, damit das Bild Christi in ihr herauskommt. . .
Laßt uns ausreißen, was einer anderen Richtung zuneigt, und unbarmherzig mit dem Hammer und dem Meißel der Abtötung herunterhauen, wie ich jetzt an einem Stein rücksichtslos schon sechs Wochen herunterhaue. Da gibt es keinen Eigenwillen von Seiten des Steines. . .
Ich meißle zwar gern die Heiligenbilder, aber viel lieber erfülle ich im Gehorsam den Willen Gottes. . .
Ich bin ein ganz armer Sünder. Der Herr muß noch viel draufschlagen, bis ein Heiligenbild daraus wird.“
In der Nachfolge des gekreuzigten Herrn:
Für viele Menschen ist die Nachfolge des Gekreuzigten ein „Ärgernis“, weil sie im Kreuz nur Tod und Untergang sehen. Der Glaubende sieht das Kreuz mit den Augen Gottes und erkennt darin „Gottes Weisheit und Gottes Kraft“, die durch das Leiden und Sterben Jesu der Welt offenbart und geschenkt wurde. Endgültiges Heil und Erlösung gibt es nur dort, wo der Mensch aus einer Quelle trinken kann, deren Wasser die Lebenskraft hat, von aller Schuld und allem Bösen zu befreien und aus dem Tod zu erlösen. Dieser ewiges Heil und ewiges Leben spendende Quell, so sieht und bekennt es dankbar der Gläubige, entsprang am Kreuz aus den fünf Wunden des gekreuzigten Herrn. Dazu äußert sich Bruder Firminus wie folgt: „Alle Leiden und Schmerzen sind unserer sündigen Natur zuwider; aber es liegt ein großes Geheimnis im Kreuz und Leiden. Das Geheimnis der Leiden des Herrn ist der Grundstein heiligen Glaubens. Das Kreuz ist der Quell allen Segens und der Ursprung aller Gnaden.“
Die Nachfolge des gekreuzigten Herrn war für Firminus vor allem der königliche Weg der göttlichen Liebe. Von dieser Liebe hatte er sich ganz gefangen nehmen lassen, und er bemühte sich, sie täglich sichtbar zu machen. Wer diesen Weg geht, geht im Tod nicht zugrunde, weil die allmächtige Liebe Gottes ihn ewig leben läßt in der Herrlichkeit des auferstandenen Leibes. Und da der Bruder Kreuz und Leid in diesem österlichen Licht der vollendeten Liebe Gottes zu sehen pflegte, nahm er täglich in großer Liebe sein und vieler Menschen Kreuz auf sich und folgte dadurch Jesus nach. Denn er hatte festgestellt: „Das Kreuz ist die bejahende schöpferische Kraft des Guten, entgegen der verneinenden Macht des Bösen.“
Leben aus dem Geheimnis der Hl. Kommunion:
Die unbegreifliche Gegenwart und Wirksamkeit des auferstandenen Herrn inmitten seiner Kirche war für Bruder Firminus die wahre Sonne, die ihm stets Licht und Leben schenkte, in der täglichen Mitfeier der hl. Messe. Hier erfuhr er die unfaßbar innige Gemeinschaft mit Christus durch die hl. Kommunion. Sie erfüllte seine Seele immer wieder mit Staunen und Dank. Sooft es ihm möglich war, ging er in die Kirche, um zu beten und sich von „der Sonne Jesu im allerheiligsten Sakrament bescheinen“ zu lassen. Auch die Anbetung des Allerheiligsten war für ihn ein Kernstück wahrer Christusliebe. Deshalb sagte er: „…reiße dich los von der Unterhaltung der Menschen und verweile von heute an täglich einige Zeit lang vor Jesus im Allerheiligsten Altarsakrament…“ Und schreibt einer Bekannten: „Was wären wir unvermögend, wenn wir nicht oft zu den hochheiligen Geheimnissen, der heiligen Kommunion hinzutreten dürften. Gehen Sie, sooft es Ihnen möglich ist. Der liebe Heiland wandelt uns dann nach und nach zu Heiligen. Liebe und Freude werden wir dann ausstrahlen gegen alle Menschen.“
O Wunder, das niemals seinesgleichen hatte, noch haben wird!
O Gnade, die wir niemals verdienen konnten!
O Liebe, die wir niemals zu erfassen vermögen!
Bruder Firminus
Im Vertrauen auf die Fürsprache Mariens:
Der Marienwallfahrtsort Neviges hatte für Bruder Firminus eine besondere Bedeutung. In dessen Gnadenbild, so scheint es, fand er weitgehend den sichtbaren Ausdruck zu jenem Bild der Gottesmutter, das er unsichtbar in seinem Herzen trug. In seiner inneren Schau sah er Maria vornehmlich in ihrer vollkommenen und vollendeten Gestalt. Ihr ganzes Leben sah er in diesem Licht. Bei ihr in der wunderbaren Eigenschaft als Gnadenvermittlerin, verweilte zunehmend sein Blick, an sie richtete er immer häufiger seine Gebete. „Gnadenvermittlerin, bitte für uns!“, schrieb er deutlich sichtbar in den Sockel jener Marienstatue, die er zu Ehren der Mittlerin aller Gnaden gestaltet hatte, und „Maria, Gnadenvermittlerin, bitte für uns!“, waren die letzten Worte, die er zwei Tage vor seinem Tod niederschrieb. Mit großem Vertrauen betete Bruder Firminus zur Gottesmutter. Von ihrer Fürbitte erhoffte er sich die größten Gnaden für sein Leben und das anderer Menschen. So schreibt er in einem Brief an den Adressaten. „Möge unsere gute, himmlische Mutter ihnen eifriges Tugendstreben und viel Freude dazu am Throne Gottes erbitten…Die mächtige Fürbitte der lieben Gottesmutter wird Sie wieder gesund machen.“
.
Auf dem Weg zu ewigen Leben:
Das von Gott dem Menschen gesetzte Ziel, das ewige Leben bei ihm, verlangt den ganzen Einsatz der Person. Wie der Weg zu diesem Ziel zu gehen und wie es zu erreichen ist, dafür ist das Leben von Bruder Firminus ein Vorbild. Fest und beharrlich ging er den Weg, den Gott im Leben Jesu vorgezeichnet hat. Er bemühte sich, keine Umwege zu machen und auf dem Weg nicht stehen zu bleiben. Daher war er auch von der Hoffnung mit Christus zu siegen und mit ihm das ewige Leben zu erben ganz erfüllt. Nur die Macht Gottes vermag es den Tod zu besiegen, mag der Mensch sonst kämpfen und siegen wie er will. In der Auferstehung Jesu Christi von den Toten hat Gott diese seine Macht erwiesen und ihn eingesetzt zum Mittler des ewigen Lebens für alle Menschen. Wer das Leben des auferstandenen Herrn in seinem Leben wirksam werden läßt durch den Glauben und die Nachfolge Christi, der wandelt schon im neuen Leben, das nach dem Tod in göttlicher Herrlichkeit sich offenbaren wird. So ist der Tod kein Feind mehr, sondern ein Bruder, der das Tor öffnet zum ewigen Leben. Davon war Firminus so fest überzeugt, daß er folgende tröstliche Worte schreiben konnte: „All unsere Werke, Gedanken und Worte müssen eine Vorbereitung zum Tode sein. Dann kann der Tod als unser Freund und Bruder jederzeit willkommen sein.“
Durch den Ruf der Heiligkeit, durch den der Diener Gottes im Leben leuchtete, hörte auch nach seinem Tod die Verehrung nicht auf. Deshalb eröffnete Joseph Kardinal Frings als Erzbischof von Köln im Jahr 1957 den Prozeß seiner Seligsprechung und Kanonisierung.
Die Kongregation für die Seligsprechung billigte dies ordnungsgemäß in einem Dekret am 24. Mai 1991.
Nach Regel und Brauch ist dann erörtert worden, ob Bruder Firminus die Tugenden in heroischer Weise geübt habe. Am 1. Juli 1997 tagte ein besonderer Kongreß mit glücklichem Ausgang über die theologischen Räte.
Am 6. Oktober 1998 bekannten in einer ordentlichen Sitzung die Kardinäle und Bischöfe, daß Bruder Firminus die theologischen Tugenden, sowie die dazugehörenden Kardinaltugenden in „heroischer Weise“ gelebt habe.
Nachdem der höchste Pontifex Johannes Paul II. über die erfolgten Schritte informiert worden war, ordnete er an das „Dekret über die heroischen Tugenden“ des Dieners Gottes aufzusetzen.
Es lautet:
„Es steht fest, daß Bruder Firminus Wickenhäuser, die theologischen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe sowohl Gott als auch dem Nächsten gegenüber, sowie die Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß und alle dazugehörigen Tugenden auf h e r o i s c h e W e i s e ausgeübt hat!“
Die Ausführungen sind dem lesenswerten Buch entnommen „Franziskanerbruder Firminus Wickenhäuser, 1876 – 1939, gelebt und gestorben im Rufe der Heiligkeit“, Herausgegeben vom BRUDER-FIRMINUS-WERK, Franziskanerkloster Düsseldorf, 2007. Auswahl der Texte und deren Kürzungen von mir.
 Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, feiern wir das Fest des hl. Apostels Thomas. Man nennt ihn auch den „ungläubigen Thomas.“ Er hatte das Pech, dass er fehlte, als Jesus erstmals seinen Jüngern und Aposteln erschienen war. Als die Jünger ihm voll Freude sagten „Wir haben den Herrn gesehen!“, entgegnete er ihnen: „Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht“ (Joh 20,25)!
Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, feiern wir das Fest des hl. Apostels Thomas. Man nennt ihn auch den „ungläubigen Thomas.“ Er hatte das Pech, dass er fehlte, als Jesus erstmals seinen Jüngern und Aposteln erschienen war. Als die Jünger ihm voll Freude sagten „Wir haben den Herrn gesehen!“, entgegnete er ihnen: „Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht“ (Joh 20,25)!
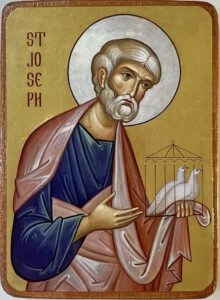

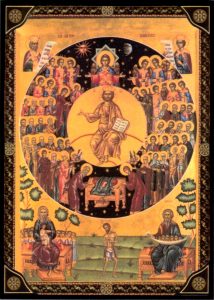

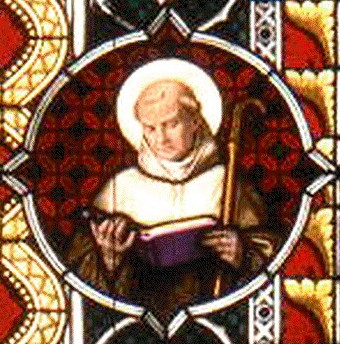
 St. Kunibert in Köln gehört zu dem großartigen Kranz der romanischen Kirchen dieser Stadt. Zwar ist das Bauwerk im letzten Kriege schwer getroffen worden, aber der Wiederaufbau fast beendet. Die Kirche erhebt sich an der gleichen Stelle dicht am Rhein, wo der hl. Kunibert, Bischof von Köln, das nach ihm benannte Stift (aufgelöst 1802) gründete, in dessen Kirche er im Jahre 663 seine Ruhestätte fand. Diese Kirche birgt auch die Reliquien der hll. Ewalde.
St. Kunibert in Köln gehört zu dem großartigen Kranz der romanischen Kirchen dieser Stadt. Zwar ist das Bauwerk im letzten Kriege schwer getroffen worden, aber der Wiederaufbau fast beendet. Die Kirche erhebt sich an der gleichen Stelle dicht am Rhein, wo der hl. Kunibert, Bischof von Köln, das nach ihm benannte Stift (aufgelöst 1802) gründete, in dessen Kirche er im Jahre 663 seine Ruhestätte fand. Diese Kirche birgt auch die Reliquien der hll. Ewalde.
 Der Monat November ist vielen von uns als Allerseelenmonat bekannt. Doch beginnt der Monat November mit dem Fest Allerheiligen, an dem die Kirche alle Heiligen im Himmel verehrt. Aber, wann ist ein Mensch ein Heiliger? Wann wird jemand als Heiliger verehrt? Zunächst einmal muß festgestellt werden: Gott ist der Allheilige. Es ist das Wesen des höchsten Gutes und der höchsten Güte, sich selbst gemäß, d.h. heilig zu sein. Gott ist auch der Urheilige, der vernunftbegabte Geschöpfe über die Möglichkeiten ihrer geschöpflichen Ordnung hinaushebt in eine übernatürliche und sie sich selbst gemäß macht und angleicht, sie heilig macht. Jedes vernünftige Geschöpf strebt zwar kraft seines Wesens nach Gott, seinem Ursprung, um in ihm Ruhe und Heimat zu finden. Aber welches Geschöpf dürfte wohl wagen, wie Gott sein zu wollen und sich eindrängen in das persönliche Leben Gottes? Das Geschöpf kann sich seinen Platz nicht wählen in der göttlichen Sphäre seines Schöpfers. Aber der Schöpfer kann – aus Gnade – das Geschöpf teilhaben lassen an seinem eigenen Leben. Und da Leben bei dem höchsten Geiste Erkennen und Lieben ist, muß der geschaffene Geist, der an seinem Leben teilhaben will, in seinem Erkennen dem göttlichen Geiste angeglichen werden.
Der Monat November ist vielen von uns als Allerseelenmonat bekannt. Doch beginnt der Monat November mit dem Fest Allerheiligen, an dem die Kirche alle Heiligen im Himmel verehrt. Aber, wann ist ein Mensch ein Heiliger? Wann wird jemand als Heiliger verehrt? Zunächst einmal muß festgestellt werden: Gott ist der Allheilige. Es ist das Wesen des höchsten Gutes und der höchsten Güte, sich selbst gemäß, d.h. heilig zu sein. Gott ist auch der Urheilige, der vernunftbegabte Geschöpfe über die Möglichkeiten ihrer geschöpflichen Ordnung hinaushebt in eine übernatürliche und sie sich selbst gemäß macht und angleicht, sie heilig macht. Jedes vernünftige Geschöpf strebt zwar kraft seines Wesens nach Gott, seinem Ursprung, um in ihm Ruhe und Heimat zu finden. Aber welches Geschöpf dürfte wohl wagen, wie Gott sein zu wollen und sich eindrängen in das persönliche Leben Gottes? Das Geschöpf kann sich seinen Platz nicht wählen in der göttlichen Sphäre seines Schöpfers. Aber der Schöpfer kann – aus Gnade – das Geschöpf teilhaben lassen an seinem eigenen Leben. Und da Leben bei dem höchsten Geiste Erkennen und Lieben ist, muß der geschaffene Geist, der an seinem Leben teilhaben will, in seinem Erkennen dem göttlichen Geiste angeglichen werden.